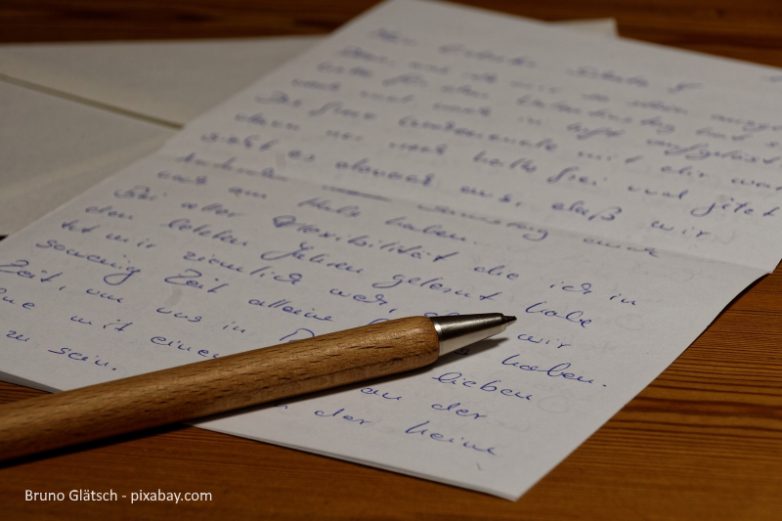Die Schwüle mancher Sommertage ist unerträglich. Darin ähnelt sie der Hitze, doch mit ihrer Feuchtigkeit drückt sie auf Menschen und Tiere. Wir und die Charaktere lauschen auf den Donner, der hoffentlich das Ende dieser Periode ankündigt. In der Zwischenzeit kann viel geschehen. Selten etwas Gutes.
Schwüle Tage und ermüdende Trägheit
Wenn es heiß und feucht ist, werden Menschen träge. Dauert der Zustand zu lange an, zeigen sie ihre negativsten Eigenschaften. George Orwell beschreibt in Tage in Burma die Auswirkungen des Klimas auf die Angehörigen der britischen Kolonialmacht. Sie flüchten in Alkohol und Intrigen, wie um sich das Leben noch schwerer zu machen.
Auch in Harper Lees Wer die Nachtigal stört spielt das Klima eine Rolle. Die reichen weißen Ehefrauen führen ihr Leben in den Häusern, wo sie körperliche Anstrengungen meiden, und Intrigen schmieden. Ihre Ehemänner verlassen das Haus, setzen sich der Hitze aus und spinnen eigene Komplotte. Ihre schwarzen Bediensteten können sich der schwülen Hitze nicht entziehen, weder dem Wetter noch der gereizten Stimmung unter den Bewohnern der Stadt.
Die Nächte zwischen Sinnlichkeit und Gewalt
In der feuchtwarmen Nacht vermischen sich die intensivierten Düfte und die schwitzige Trägheit zu erotischer Langsamkeit. Scheinbar ist es ein Paradies, doch zum Paradies gehört die Schlange. Es drohen Verrat oder Erpressung, es droht Desillusionierung, und die weckt die Wut.
In Salman Rushdis Die satanischen Verse kommt der zu einer Art Teufel mutierte Saladin in einem Londoner Hotel unter. Die Temperatur in der Stadt steigt, die Nächte werden tropisch und sinnlich, gleichzeitig steigt die Aggression unter der Bevölkerung, die sich schließlich in Rassenunruhen entlädt.
Ein Bruch des Wetters erscheint als Befreiung. Ein Gewitter kann die Luft klären und neue Hoffnung geben. Ein Gewaltausbruch bringt nur neue Verletzungen mit sich, die den Keim für neue Aggressionen in sich tragen.